
Back(wards) to trait approach? Die (un-)heimliche Renaissance personifizierter Kompetenz
0 Kommentare
/
Führung – oder besser: Leadership – ist, soviel ist sicher…

Kompetenz kommt von Können ... oder nicht?
„Kompetenz“ ist für uns ein Werturteil. Darin steckt vor…

Das Petra-Prinzip - gut gemacht ist besser als gut gemeint
… oder: warum allzu gut gemeinte Frauenförderung auch ins…
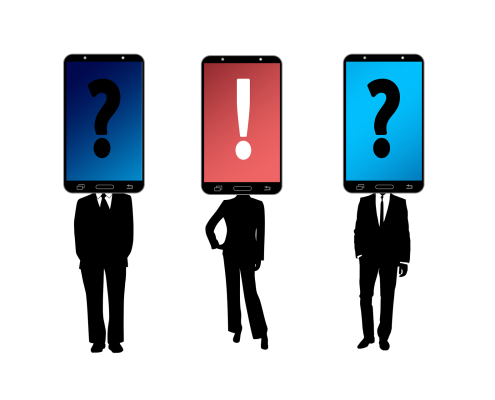
Frauen führen anders!?
Das Rollenspiel von Männern und Frauen im Beruf
.. ein Selbsttest:…
