
Wanted: New Learning - aber was heißt das genau?
0 Kommentare
/
Alle sprechen vom New Learning (wir auch :-)) – aber was heißt…

Höher? Weiter? Tiefer? Im Dreisprung zum Erfolg
Hop - step - jump, so gelingt mit der richtigen Schritt- und…
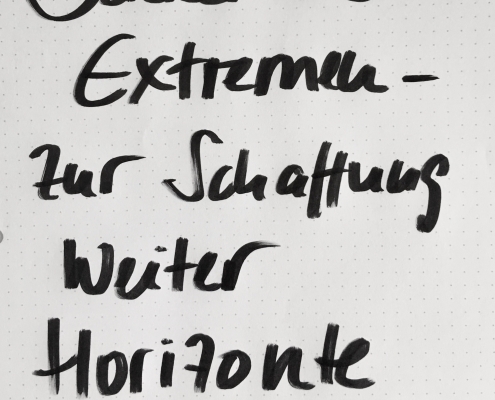
... ist das denn noch Controlling?
… und was hat das alles mit unserem "eigentlichen" Business…

Erst lernen, dann führen - Plädoyer für einen Perspektivwechsel
Leadership ist - in vielzähligen Bindestrichvarianten - wieder…

Risikomanagement 4.0: Steuerung statt rechtlicher Absicherung!
Ein sinnvolles Risikomanagement umfasst weit mehr als die Erfüllung…

Führung schwarz-weiß. Perspektivenwechsel für den Führungserfolg
Wir können das Phänomen „Führung“ bis heute nicht begreifen.…
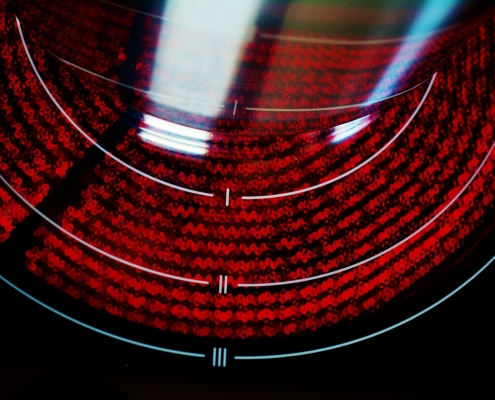
Learning Leaders – wie Sie Ihr Unternehmen wertvoll machen!
In unseren Seminaren und Vorträgen kommt sie seit vielen Jahren…

Bunt, quer, nützlich und innovativ: ein Plädoyer für die Liberal Arts
Über MOOCs lässt sich bildungs- und gesellschaftspolitisch…
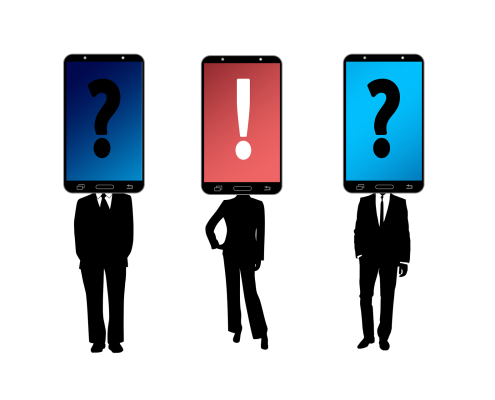
Frauen führen anders!?
Das Rollenspiel von Männern und Frauen im Beruf
.. ein Selbsttest:…

Smart enough? Alte Bildungsideale neu entdeckt
In der Diskussion um smartes Lernen, digitale Bildung, Wissensvermittlung…

Wirtschaft und Verantwortung – digital neu dimensioniert
Die aktuellen Veränderungen der Innen- und Außenwelt von Organisationen…
