
Back(wards) to trait approach? Die (un-)heimliche Renaissance personifizierter Kompetenz
0 Kommentare
/
Führung – oder besser: Leadership – ist, soviel ist sicher…

Wanted: New Learning - aber was heißt das genau?
Alle sprechen vom New Learning (wir auch :-)) – aber was heißt…

70-20-10: ein alter Hut, der auch in Zukunft noch passt!
Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wann und…

Kompetenz kommt von Können ... oder nicht?
„Kompetenz“ ist für uns ein Werturteil. Darin steckt vor…

Qualifiziert!? Können Sie vergessen....
Wie oft hören wir mit Stolz: „unsere Leute können etwas,…
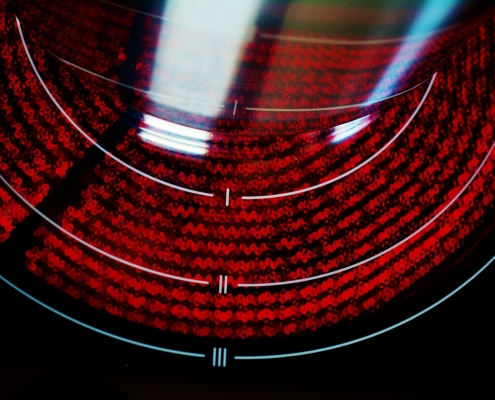
Learning Leaders – wie Sie Ihr Unternehmen wertvoll machen!
In unseren Seminaren und Vorträgen kommt sie seit vielen Jahren…

Bunt, quer, nützlich und innovativ: ein Plädoyer für die Liberal Arts
Über MOOCs lässt sich bildungs- und gesellschaftspolitisch…

Tief mal breit? Die Neuerfindung der lernenden Organisation
Was kommt Ihnen beim Thema betriebliche Aus- und Weiterbildung…

Smart enough? Alte Bildungsideale neu entdeckt
In der Diskussion um smartes Lernen, digitale Bildung, Wissensvermittlung…

Postfaktisch oder mit Gefühl!?
Zeitdiagnose im Spiegel deutscher Sprachkritik
Was war gut,…

Bildung macht unglücklich!?
Kritik hat immer Konjunktur: Ganz gleich, ob wir uns mit dem…

Ich lerne, Du lernst ... bis das ganze Unternehmen lernt!?
Die Idee der lernenden Organisation ist bereits ein Viertel Jahrhundert…
