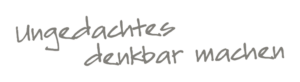Beiträge

Die aktuelle CFO-Agenda: Skills um Skills ... doch keine Transformation
0 Kommentare
/
Im modernen Sprachgebrauch dürfen sie sich gerade über ein…

Wanted: New Learning - aber was heißt das genau?
Alle sprechen vom New Learning (wir auch :-)) – aber was heißt…

70-20-10: ein alter Hut, der auch in Zukunft noch passt!
Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wann und…

Qualifiziert!? Können Sie vergessen....
Wie oft hören wir mit Stolz: „unsere Leute können etwas,…

Ich lerne, Du lernst ... bis das ganze Unternehmen lernt!?
Die Idee der lernenden Organisation ist bereits ein Viertel Jahrhundert…