Beiträge

Controlling im digitalen Zeitalter - Herausforderungen und Lösungsansätze
0 Kommentare
/
Die „Digitalisierung“ wirkt auf die drei wesentlichen Treiber…

Digitalisierung für Einsteiger: Episode 2 – Drei Gründe gegen Social Media
Drei Gründe gegen Social Media - inkl. einiger Hinweise, wie sich die subjektive Aversion hinter der objektiven Argumentation entblößen lässt.

Öfters mal die Perspektive wechseln: Betriebssysteme des Change Managements
Was befähigt uns, in extrem schwierigen Situationen einfache…
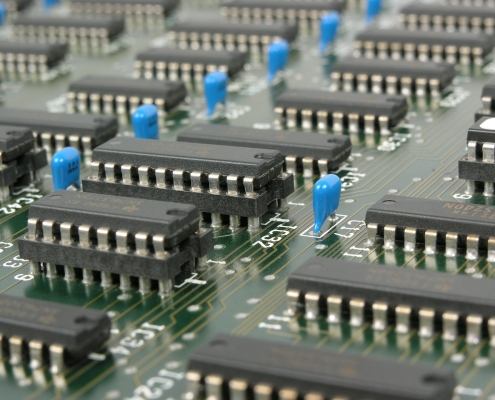 https://ungedachtes-denkbar-machen.de/wp-content/uploads/2016/08/technology_1472636557.jpg
960
1280
Anja Ebert-Steinhübel
https://ungedachtes-denkbar-machen.de/wp-content/uploads/2024/02/ungedachtes-Schriftzug-300x82.png
Anja Ebert-Steinhübel2014-08-08 09:32:252016-11-07 10:34:16Digitalisierung. Macht. Dumm?
https://ungedachtes-denkbar-machen.de/wp-content/uploads/2016/08/technology_1472636557.jpg
960
1280
Anja Ebert-Steinhübel
https://ungedachtes-denkbar-machen.de/wp-content/uploads/2024/02/ungedachtes-Schriftzug-300x82.png
Anja Ebert-Steinhübel2014-08-08 09:32:252016-11-07 10:34:16Digitalisierung. Macht. Dumm?
#Neuland Unternehmensstrategie
Als unsere Kanzlerin vor wenigen Wochen das Internet – mehr…

Risikomanagement an Hochschulen
Die Tatsache, dass Hochschulen keine Unternehmen im klassischen…

Management und Sozialwirtschaft – Mehrwert oder Widerspruch?
Stellen die Konzepte und Instrumente des modernen Managements…
