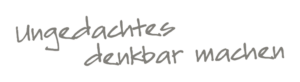https://ungedachtes-denkbar-machen.de/wp-content/uploads/2012/10/Quadr-1-B.jpg
1200
1200
Volker Steinhübel
https://ungedachtes-denkbar-machen.de/wp-content/uploads/2024/02/ungedachtes-Schriftzug-300x82.png
Volker Steinhübel2013-02-21 10:23:182016-09-21 14:56:13Weiterbildung 2013!
https://ungedachtes-denkbar-machen.de/wp-content/uploads/2012/10/Quadr-1-B.jpg
1200
1200
Volker Steinhübel
https://ungedachtes-denkbar-machen.de/wp-content/uploads/2024/02/ungedachtes-Schriftzug-300x82.png
Volker Steinhübel2013-02-21 10:23:182016-09-21 14:56:13Weiterbildung 2013!
Controlling im Mittelstand
Hier ein paar Links zum Thema Controlling im Mittelstand:
http://www.computerwoche.de/a/effizienteres-controlling-fuer-kmus,2531429
http://www.itmittelstand.de/home/newsdetails/article/konzentration-auf-das-wesentliche-2.html
http://www.pressebox.de/pressemitteilung/addison-software-und-service-gmbh/Integrierte-Loesung-ermoeglicht-Konzentration-auf-das-Wesentliche-und-absolute-Transparenz/boxid/569079
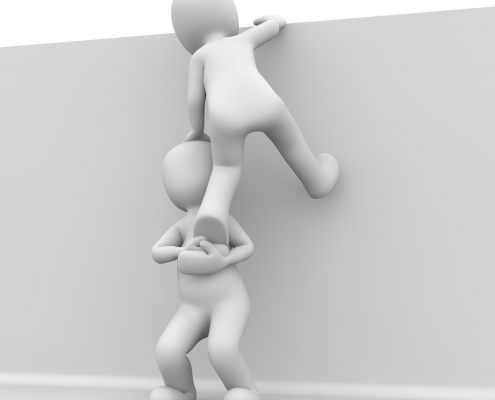
Vertrieb und Controlling – eine neue Freundschaft?!
Vertrieb und Controlling – eine neue Freundschaft?!
In volatilen…

Fachtagung Controllinglösungen für die Praxis 2012
Die Rolle des Controllers in der Zukunft wird als "Performance Berater für die Businessmanager" definiert. Für diese Herausforderung bietet die Fachtagung "Controllinglösungen für die Praxis" 2012 der IFC EBERT Lösungsansätze.

Fachtagung Instandhaltung am 04./05.12.2012 in Nürnberg
"Der Instandhalter als kompetenter Manager der Wertschöpfung, der Lebenszyklus- und Energieeffizienz sowie von zukunftsfähigen Wissens- und Servicekonzepten im Unternehmen." Das ist die Rolle des Instandhalters in der Zukunft.

Dreamteam: Instandhaltung und Controlling?!
Dreamteam: Instandhaltung und Controlling?! - Ungedachtes denkbar machen

Talente finden, Kompetenzen entwickeln, Performance steigern!
Unter diesem Titel referierte Dr. Anja Ebert-Steinhübel, Seniorberaterin…

Erfolg, weil andere Erfolg haben - Vier Jahrzehnte Controlling
Erfolg! Vier Jahrzehnte Controlling - Eine Erfolgsgeschichte
40…