Beiträge

Die aktuelle CFO-Agenda: Was ist eigentlich KI?
0 Kommentare
/
„In der heutigen Zeit ist Künstliche Intelligenz (KI) ein…
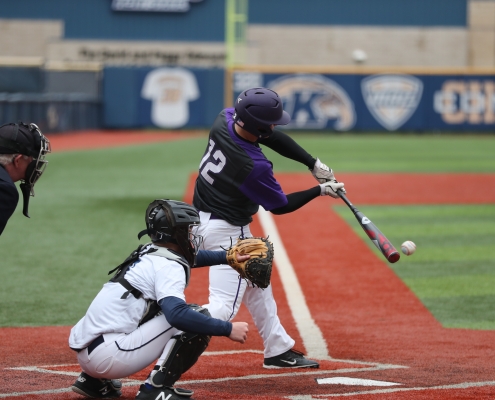
Das Ende der One-Man-Show – Zeit für modernes Business Partnering
Die Suche nach der passenden Rolle für das Controlling in der…

Controlling im digitalen Zeitalter - Herausforderungen und Lösungsansätze
Die „Digitalisierung“ wirkt auf die drei wesentlichen Treiber…

Open Space – das neue Raumwunder sozialer Kommunikation
Stopp – nicht gleich aufhören zu lesen, wenn Sie gleich merken,…

Digitalisierung ist nicht das Problem, sondern die Lösung....
Eine Erkenntnis, die wir aus der Corona-Krise gewonnen haben,…

It's all about communication - still in the digital world
Alle reden von Digitalisierung, wer aber spricht noch über Kommunikation?…

Jenseits von Schwarz und Weiß – zur Ambivalenz "schöpferischer" Disruption
Wie dringlich ist der Appell zur Veränderung? Welche Radikalität…

Tief mal breit? Die Neuerfindung der lernenden Organisation
Was kommt Ihnen beim Thema betriebliche Aus- und Weiterbildung…

Digitalisierung für Einsteiger: Episode 2 – Drei Gründe gegen Social Media
Drei Gründe gegen Social Media - inkl. einiger Hinweise, wie sich die subjektive Aversion hinter der objektiven Argumentation entblößen lässt.

Digitalisierung für Einsteiger: Episode 1 - Von falschen Gegensätzen und immensen Randgruppen
Das Thema Digitalisierung beherrscht die aktuelle Diskussion…

Bildung macht unglücklich!?
Kritik hat immer Konjunktur: Ganz gleich, ob wir uns mit dem…

The digital turn(s) into reality
Warten Sie noch, oder sind Sie schon mitten drin? The turn is…
